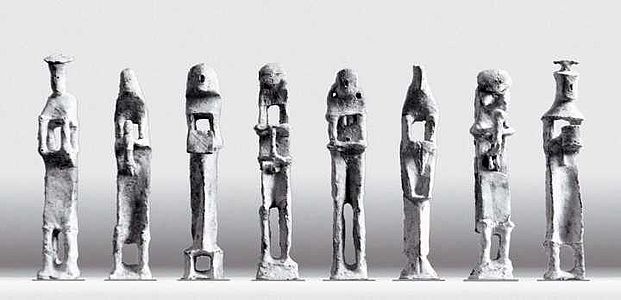Kachel
Verfasst von:

Ofenkachel | Ende 15. Jh.
Nach einer Kupferstichvorlage des Meisters E. S. gefertigt | aus Süddeutschland oder Schweiz
H: 21 cm, B: 18,5 cm, T: ca. 5 cm
Material/Technik:Ton, reliefiert, grün glasiert
Beschreibung zu diesem Beispiel
Die hochrechteckige grün glasierte Ofenkachel aus dem 15. Jh. modellierte in Ton ein unbekannter Künstler nach einem Stich des Meisters E. S. Auf der Kachel befindet sich ein vertieftes Feld, das seitlich von Säulen und oben von einem Bogen abgeschlossen ist. Es beinhaltet eine Darstellung einer jungen Frau im mittelalterlichen Gewand. Die geflochtenen Zöpfe sind um ihre Ohren gelegt. Eine stilisierte Krone und ein Diadem mit einer mittig platzierten Blume bekrönen die Frau. In ihrer rechten Hand hält sie eine Büste eines bärtigen Mannes mit Stechhelm. Mit ihrer linken Hand hält sie die Schleppe ihres Gewandes. Wie ein Ornament ranken sich stilisierte Pflanzen im Hintergrund.
Dietrich, Gerhard: Museum. Museum für Angewandte Kunst Köln, Braunschweig 1989, S. 40–55.
Henkel, Matthias (Diss.): Der Kachelofen. Ein Gegenstand der Wohnkultur im Wandel (...), Nürnberg 1999, S. 4–7.
Klesse, Brigitte: Museum für Angewandte Kunst Köln, Querschnitt durch die Sammlungen, Köln 1989, S. 25.
Löber, Ulrich: Die zündende Idee, Keramik in der Technik (Begleitpublikation zur Sonderausstellung Die zündende Idee), Koblenz 1997.
Aspekte, Zielgruppen & MethodenHilfe
Aspekte

Beim Vergleich werden die Teilnehmer*innen auf Unterschiede oder Ähnlichkeiten aufmerksam.
Ohne Vorwissen können sie aus ihrer Wahrnehmung heraus zu den wichtigsten Erkenntnissen kommen. Dabei schult der Vergleich die Differenzierung der Wahrnehmung. Je nach Art des Vergleichs fokussiert er die Aufmerksamkeit auf Unterschiede oder Ähnlichkeiten. Je ähnlicher sich die Vergleichsobjekte im Museum sind, desto mehr „Feinheiten“ entdecken die Teilnehmer*innen.
Es bieten sich zwei Möglichkeiten an: zum einen der Vergleich von Originalen, zum anderen der Vergleich von Originalen und Reproduktionen.
Anwendung auf das Exponat Kachel
Neben der Kachel werden weitere Objekte vorgestellt, wie z. B.: Steinzeug, Irdengut, Majolika, Fayence und Porzellan. Durch den Vergleich der Objekte aus unterschiedlichen Epochen und Ländern verstehen die Teilnehmer*innen die Entwicklung der Keramik.
Czech, Alfred/Kirmeier, Josef/Sgoff, Brigitte (Hg.): Museumspädagogik - Ein Handbuch. Grundlagen und Hilfen für die Praxis, Schwalbach/Ts. 2014, S. 204.
- Alltagsleben
- Bauweise
- Details
- Eigenschaft
- Erfindung
- Funktion
- Kulturen
- Materialität
- Ressourcen
- Technik
- 6-10 Jahre
- 10-13 Jahre
- 13-16 Jahre
- 16-18 Jahre
- Familien
- Kinder und Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Die Teilnehmer*innen vergleichen und recherchieren Funktionen von Objekten in verschiedenen Epochen und präsentieren ihre Ergebnisse.
Sie lernen maximal fünf Exponate kennen. Durch Recherche, Vergleiche und Brainstorming ermitteln die Teilnehmer*innen die ursprüngliche Funktion der Objekte. Gleichzeitig machen sie sich Gedanken darüber, ob ähnliche Objekte heute in gleicher Weise genutzt werden. So werden Unterschiede der Kulturen klar, aber auch Gemeinsamkeiten deutlich. Kleinere Kinder halten ihre Ideen zeichnerisch fest, Ältere präsentieren ihre Ergebnisse auf Tafeln und als Kurzvortrag.
Anwendung auf das Exponat Kachel
Mit dieser Methode beleuchtet der*die Vermittler*in z. B. die Techniken des Heizens und die Entwicklung der Ofenarchitektur in Wohnräumen. Dabei steht die Keramik als Schlüsselwerkstoff im Mittelpunkt. Wenn die Kachel ihrem ursprünglichen Zusammenhang beraubt ist, soll gemeinsam überlegt werden, wie sie wohl z. B.: auf einem Ofen positioniert war, wie dieser ausgesehen haben könnte und in welchem Raum er als ressourcensparende Wärmequelle genutzt wurde. Abbildungen helfen bei den Überlegungen von Einsatz und Funktion der Kachel damals und heute.
Czech, Alfred: Methodische Vielfalt in der personalen Vermittlung, in: Czech, Alfred/Kirmeier, Josef/Sgoff, Brigitte (Hg.): Museumspädagogik - Ein Handbuch. Grundlagen und Hilfen für die Praxis, Schwalbach/Ts. 2014, S. 198–224, hier: S. 203 f.
Bundesverband Museumspädagogik: Methodensammlung Museen und Kindergärten, 2010, Nr. 7, https://www.museen-und-kindergaerten.de/methodenkartei/alle-methoden-auf-einen-klick/
Nettke, Tobias: Personale Vermittlung in Museen. Merkmale, Ansätze, Formate und Methoden, in: Commandeur, Beatrix u.a. (Hg.), Handbuch Museumspädagogik. Kulturelle Bildung in Museen, München 2016, S. 173–183, hier: S. 174–175.
- Alltagsleben
- Bauweise
- Details
- Eigenschaft
- Erfindung
- Funktion
- Kulturen
- Materialität
- Ressourcen
- Technik
- 6-10 Jahre
- 10-13 Jahre
- 13-16 Jahre
- 16-18 Jahre
- Familien
- Kinder und Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Materialproben ermöglichen es, Materialeigenschaften eines Exponats zu erkunden.
Die Proben machen das Exponat erfahrbar, da in der Regel aus konservatorischen Gründen Museumsobjekte nicht berührt werden dürfen. Erhalten die Teilnehmer*innen Materialproben in die Hand, erleben sie haptisch Materialeigenschaften wie Oberflächenstruktur, Härte, Form, Gewicht oder auch Klang eines Materials. Der Einsatz von mehreren Materialproben ist sinnvoll, um im Vergleich besondere Eigenschaften und Unterschiede noch deutlicher zu erkennen. Auch bildlich dargestellte Materialien werden durch reale Materialproben „begreifbar“.
Anwendung auf das Exponat Kachel
In der Museumswerkstatt erhalten die Teilnehmer*innen die Gelegenheit, sich haptisch mit den Keramiken auseinanderzusetzen. Im Anschluss sollen sich die Teilnehmer*innen überlegen, wie die Kachel wohl bearbeitet wurde. Es stellt sich die Frage, warum gerade Kacheln aus Ton als Ofenverkleidung seit Jahrhunderten zum Einsatz kommen. Gemeinsam erarbeitet die Gruppe über das Anfassen des Materials Funktion und Eigenschaften der Kacheln.
Busse, Klaus-Peter: Bildumgangsspiele: Kunst unterrichten, Dortmund 2004, S. 87.
Seitz, Rudolf: Phantasie & Kreativität. Ein Spiel-, Nachdenk- und Anregungsbuch, München 1998, S. 56.
Bezirk Oberfranken (Hg.): Musbi. Museum bildet. Methodenkärtchen, Bayreuth 2014.
Bundesverband Museumspädagogik: Methodensammlung Museen und Kindergärten, 2010, Nr. 37, 47, 66, https://www.museen-und-kindergaerten.de/methodenkartei/alle-methoden-auf-einen-klick/
- Alltagsleben
- Bauweise
- Details
- Eigenschaft
- Erfindung
- Funktion
- Kulturen
- Materialität
- Ressourcen
- Technik
- 6-10 Jahre
- 10-13 Jahre
- 13-16 Jahre
- 16-18 Jahre
- Familien
- Kinder und Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
- Menschen mit besonderen Bedürfnissen