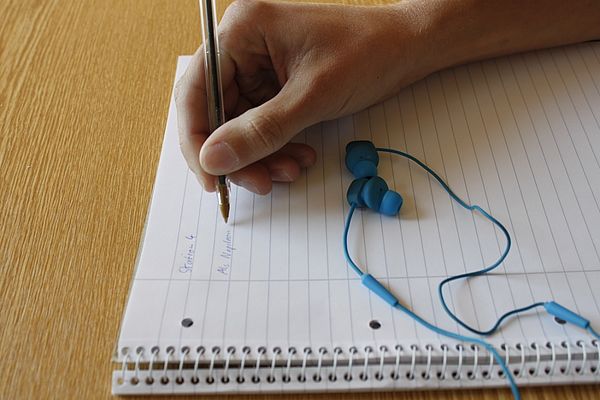Spinnrad
Verfasst von:

Tretspinnrad | um 1900
Von Ingolstadt-Unsernherrn
Durchmesser: 37,5 cm
Material/Technik:Holz, Buche
Beschreibung zu diesem Beispiel
Dieses Spinnrad mit einem Rocken wurde zum Spinnen von Flachs in der Hauswirtschaft für den Eigenbedarf an Leinen verwendet. Das Stockspinnrad in senkrechter Bauweise wurde mit einem Pedal angetrieben. Die ersten Formen des Spinnrades (Spindelräder, die mit der Hand angetrieben wurden) gelangten gegen Ende des 12. Jh. aus dem orientalischen Raum nach Europa. Das Spinnrad begann sich im 13. Jh. in Mitteleuropa zu verbreiten. Das Spinnen mit der Handspindel ist neben Verzwirnen und Flechten der älteste Herstellungsvorgang zur Gewinnung eines Fadens aus den Rohstoffen Wolle und Pflanzenfasern. Frühe europäische Funde von Handspindeln (auch Spinnwirteln) aus Ton, Stein und Knochen stammen aus der Jungsteinzeit.
Bohnsack, Almut: Spinnen und Weben. Entwicklung von Technik und Arbeit im Textilgewerbe, Hamburg 1981.
Mestemacher, Jürgen Heinrich: Altes bäuerliches Arbeitsgerät in Oberbayern, München 1985, S. 72–81.
Siuts, Hinrich: Bäuerliche und handwerkliche Arbeitsgeräte in Westfalen, Aschendorff 1988, S.148–166.
Aspekte, Zielgruppen & MethodenHilfe
Aspekte

Die Teilnehmer*innen betrachten das Objekt unvoreingenommen und beschreiben das, was sie sehen.
Durch die Betrachtung beginnt das Objekt zu sprechen. Gezielte Fragestellungen des Vermittlers/der Vermittlerin führen zu einer bewussteren Wahrnehmung, die es den Teilnehmern/innen ermöglicht, sich ohne Vorkenntnisse dem Exponat zu nähern. Damit wird der Blick des/der Betrachters*in unverstellt auf das Exponat gelenkt.
Anwendung auf das Exponat Spinnrad
Zu Beginn beschreibt der*die Vermittler*in das Exponat mit wenigen Sätzen, ohne es zu benennen. Die Teilnehmer*innen betrachten mehrere Objekte im Raum und suchen das beschriebene Spinnrad heraus. Im nächsten Schritt beschreibt die Gruppe gemeinsam weitere Details vor dem Objekt. Die gezielten Fragen des Vermittlers/der Vermittlerin zum Thema Verwendungszweck und Handhabung bringen die Besucher*innen dazu, selbst über einzelne Bestandteile und die Mechanik nachzudenken.
Czech, Alfred/Kirmeier, Josef/Sgoff, Brigitte (Hg.): Museumspädagogik - Ein Handbuch, Schwalbach 2014, S. 204.
- Alltagsleben
- Antrieb
- Bestandteile
- Handhabung
- Material
- Rohstoffe
- Rollenzuschreibung
- Verwendung
- Zeitaufwand
- Zeitlicher Wandel
- bis 3 Jahre
- 3-6 Jahre
- 6-10 Jahre
- 10-13 Jahre
- 13-16 Jahre
- 16-18 Jahre
- Familien
- Kinder und Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Die Teilnehmer*innen richten beliebige Fragen an ein Ausstellungsobjekt. Der*die Vermittler*in antwortet darauf aus der Sicht des Objekts in Ich-Form.
Der*die Vermittler*in benötigt ein umfassendes Wissen über das Exponat. Denn die Interessen und Fragen der Teilnehmer*innen lenken dessen Erschließung. Sie bestimmen die thematischen Schwerpunkte, die Intensität und die Dauer des Gesprächs. Bei der Analyse von Kunstwerken oder Abbildungen, bietet sich eine Variante der Methode an: Der*die Vermittler*in kann, statt die Rolle eines Objektes zu übernehmen, als Künstler*in, Expert/in oder abgebildete Person auftreten.
Anwendung auf das Exponat Spinnrad
Diese Methode ist besonders für jüngere Kinder geeignet, die noch nie ein Spinnrad gesehen haben. Sie können sich ohne Vorwissen mit Fragen dem Exponat annähern. Der*die Vermittler*in kann zu seinen/ihren Erläuterungen weitere Objekte im Raum oder Bilder heranziehen, um den textilen Werkprozess und das spätere Produkt anschaulicher zu machen.
Czech, Alfred: Führung - Führungsgespräch - Gespräch, in: Wagner, Ernst/Dreykorn, Monika (Hg.): Museum - Schule - Bildung, München 2007, S. 161f.
- Alltagsleben
- Antrieb
- Bestandteile
- Handhabung
- Material
- Rohstoffe
- Rollenzuschreibung
- Verwendung
- Zeitaufwand
- Zeitlicher Wandel
- bis 3 Jahre
- 3-6 Jahre
- 6-10 Jahre
- 10-13 Jahre
- 13-16 Jahre
- 16-18 Jahre
- Familien
- Kinder und Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Die Teilnehmer*innen erschließen sich Materialeigenschaften und Funktionsweisen von Werkzeugen, Geräten und Gebrauchsgegenständen durch eigenes Experimentieren.
Nach einer kurzen Einweisung fordert der*die Vermittler*in sie auf, Materialien zu erkunden, ein Verfahren, eine Technik selbst auszutesten oder ein Gerät anzuwenden. Hierbei ist es wichtig, dass der*die Vermittler*in den Schwerpunkt auf das Erproben und die eigene Erfahrung legt und nicht die Perfektion und die Vollständigkeit der Tätigkeit das Ziel ist. Z. B. weben die Teilnehmer*innen mit einem nachgebauten Webstuhl oder legen eine römische Toga an. Dadurch können sie den Zeitaufwand und die nötige Handfertigkeit nachvollziehen.
Anwendung auf das Exponat Spinnrad
Da das Spinnrad und das Spinnen von Wolle oder Flachs Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen heute nicht mehr vertraut sind und man sich den Arbeitsvorgang schlecht vorstellen kann, verstärkt die Vorführung des Gerätes durch einen Experten/eine Expertin die Anschaulichkeit der Handhabung des Gegenstands und die Eigenschaft des Naturproduktes. Noch einprägsamer ist die eigene Wahrnehmung beim selbst Ausprobieren des Arbeitsprozesses. Selbst Kleinkinder können einen Teil des Spinnrades bedienen (z. B. Halten der Faser; Treten des Antriebpedals).
Dreykorn, Monika, Methoden zur Nachbereitung eines Museumsbesuchs, in: Wagner, Ernst/Dreykorn, Monika (Hg.): Museum. Schule. Bildung, München 2007, S. 182.
Hille, Carmen: Geschichte im Blick. Historisches Lernen im Museum, in: Czech, Alfred/Kirmeier, Josef/Sgoff, Brigitte (Hg.): Museumspädagogik. Ein Handbuch. Grundlagen und Hilfen für die Praxis, Schwalbach 2014, S. 84–90, 276–278.
Bundesverband Museumspädagogik: Methodensammlung Museen und Kindergärten, 2010, Nr. 51, https://www.museen-und-kindergaerten.de/methodenkartei/alle-methoden-auf-einen-klick/
- Alltagsleben
- Antrieb
- Bestandteile
- Handhabung
- Material
- Rohstoffe
- Rollenzuschreibung
- Verwendung
- Zeitaufwand
- Zeitlicher Wandel
- bis 3 Jahre
- 3-6 Jahre
- 6-10 Jahre
- 10-13 Jahre
- 13-16 Jahre
- 16-18 Jahre
- Familien
- Kinder und Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Materialproben ermöglichen es, Materialeigenschaften eines Exponats zu erkunden.
Die Proben machen das Exponat erfahrbar, da in der Regel aus konservatorischen Gründen Museumsobjekte nicht berührt werden dürfen. Erhalten die Teilnehmer*innen Materialproben in die Hand, erleben sie haptisch Materialeigenschaften wie Oberflächenstruktur, Härte, Form, Gewicht oder auch Klang eines Materials. Der Einsatz von mehreren Materialproben ist sinnvoll, um im Vergleich besondere Eigenschaften und Unterschiede noch deutlicher zu erkennen. Auch bildlich dargestellte Materialien werden durch reale Materialproben „begreifbar“.
Anwendung auf das Exponat Spinnrad
Idealerweise zeigt der*die Vermittler*in verschiedene Proben des gesamten Prozesses der Textilherstellung vom Rohstoff tierischer und/oder pflanzlicher Faser (z. B. Schafwolle, Flachsstängel) bis zum gewebten Stoff oder gestrickten Kleidungsstück. Auf diese Weise können die Besucher*innen mittels Ertasten, Erfühlen, Riechen die Wandlung des Naturstoffes nachvollziehen und selbst erfahren. Der*die Vermittler*in fordert ergänzend die Teilnehmer*innen auf, Adjektive für die Sinneswahrnehmungen zu nennen.
Busse, Klaus-Peter: Bildumgangsspiele: Kunst unterrichten, Dortmund 2004, S. 87.
Seitz, Rudolf: Phantasie & Kreativität. Ein Spiel-, Nachdenk- und Anregungsbuch, München 1998, S. 56.
Bezirk Oberfranken (Hg.): Musbi. Museum bildet. Methodenkärtchen, Bayreuth 2014.
Bundesverband Museumspädagogik: Methodensammlung Museen und Kindergärten, 2010, Nr. 37, 47, 66, https://www.museen-und-kindergaerten.de/methodenkartei/alle-methoden-auf-einen-klick/
- Alltagsleben
- Antrieb
- Bestandteile
- Handhabung
- Material
- Rohstoffe
- Rollenzuschreibung
- Verwendung
- Zeitaufwand
- Zeitlicher Wandel
- bis 3 Jahre
- 3-6 Jahre
- 6-10 Jahre
- 10-13 Jahre
- 13-16 Jahre
- 16-18 Jahre
- Familien
- Kinder und Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Die Teilnehmer*innen schreiben einen eigenen Audioguide-Text zu einem Exponat, das sie zuvor in der Gruppe erschlossen haben.
Sie verfassen den Text zunächst in schriftlicher Form. Danach nehmen sie ihn mit Hilfe eines Computers oder eines MP3-Players als Hörtext auf.
Einige Hinweise erleichtern das Schreiben und Aufnehmen:
- Texte von max. 240 Wörtern schreiben
- das Exponat kurz beschreiben
- interessante, zusammenhängende Geschichte erzählen
- kurze, einfache Aktivsätze formulieren
- Alltagssprache verwenden
- Fachbegriffe vermeiden oder erklären
- passende Geräusche einbauen
- bei der Aufnahme langsam und deutlich sprechen
Im Anschluss hören die Teilnehmer*innen vor dem Exponat den Hörtext an.
Anwendung auf das Exponat Spinnrad
Beim Verfassen des Textes soll das Spinnen als Frauenarbeit im Haushalt und Handwerk im Mittelpunkt stehen. Die Teilnehmer*innen beleuchten die Herstellung von textilen Gebrauchsgegenständen für den Eigenbedarf und den Verkauf und die damit zusammenhängenden Lebensbedingungen der Gesellschaft. Hierzu könnten die Teilnehmer*innen aus der Sicht eines Mädchens oder einer Frau schreiben. Zusätzlich können sie die Geselligkeit bei der gemeinsamen Arbeit und die kommunikative Atmosphäre, z. B. mit der Entstehung von Redensarten wie „sein Garn spinnen“ (erfundene Geschichten erzählen) beschreiben.
Wenzel, Birgit: Kreative und innovative Methoden. Geschichtsunterricht einmal anders, Schwalbach/Ts. 2010, S. 40–46.
https://www.audiobeitraege.de/category/schreiben-fuers-hoeren/
https://www.tanjapraske.de/wissen/lehre/schreiben-fuers-hoeren-audioguides-und-apps/
- Alltagsleben
- Antrieb
- Bestandteile
- Handhabung
- Material
- Rohstoffe
- Rollenzuschreibung
- Verwendung
- Zeitaufwand
- Zeitlicher Wandel
- bis 3 Jahre
- 3-6 Jahre
- 6-10 Jahre
- 10-13 Jahre
- 13-16 Jahre
- 16-18 Jahre
- Familien
- Kinder und Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
- Menschen mit besonderen Bedürfnissen