Wasserstampfer
Verfasst von:

Wasserstampfer in anthropomorpher Gestalt | vor 1913
Aus Kanduonum, Mittlerer Sepik, Papua-Neuguinea
H: 152 cm, Durchmesser: 26 cm
Material/Technik:Holz, geschnitzt
Beschreibung zu diesem Beispiel
Der auch als Wassertrommel bezeichnete Wasserstampfer aus Papua-Neuguinea kommt bei den Iatmul am Sepik zur Anwendung. Er ähnelt einer Handtrommel, hat aber keine Bespannung. Die sich am Korpus befindenden Figuren werden als Griff benutzt. Im Rahmen der Initiationsriten für junge Männer findet der sogenannte „Tanz der Wasserstampfer“ statt. Dabei werden diese Stampfer ins Wasser gestoßen, wobei ein glucksendes Geräusch entsteht. Dieses Geräusch markiert das Auftauchen eines mythischen Schöpferkrokodils. Die Verzierung am Wasserstampfer stellt den Ablauf der Initiation dar: Das Schöpferkrokodil „frisst“ den Jungen (tötet ihn), und er wird als erwachsener Mann wieder „ausgespuckt“ (wiedergeboren). Darüber hinaus wurde der Stampfer zur Einweihung von Kopfjagdkanus eingesetzt, wobei er ebenfalls ins Wasser gestoßen wurde, um den Gesang zweier mythischer Fische zu erzeugen.
Literatur zum Thema Wasserstampfer
Appel, Michaela (Hg.): Ozeanien. Weltbilder der Südsee, München 2005, S. 72–75.
Olig, Silke: Zeichen am Sepik: Die Neuguinea-Sammlung des Seeoffiziers Joseph Hartl von 1912 und 1913 im Staatlichen Museum für Völkerkunde München als semiotischer Untersuchungsgegenstand, Dissertation, Fakultät für Kulturwissenschaften, LMU, München 2006, S. 217.
Aspekte, Zielgruppen & MethodenHilfe
Aspekte

Die Teilnehmer*innen stellen abwechselnd Fragen an das Exponat.
Hier geht es nicht um Antworten, sondern nur um Fragen. Die Teilnehmer*innen stellen so lange Fragen, bis ihre Fantasie erschöpft ist. Am Anfang sind daher Exponate hilfreich, die provokativ wirken und unmittelbar Fragen anstoßen. Der*die Vermittler*in beantwortet die gestellten Fragen oder leitet sie an die Gruppe weiter.
Variante: Der*die Vermittler*in stellt die Fragen, und die Teilnehmer*innen überlegen sich Antworten. Die Fragen werden abschließend z. B. in einer Wandzeitung festgehalten. Die Teilnehmer*innen schreiben ihre Fragen auf Karteikarten auf und befestigen diese an einer Stellwand.
Anwendung auf das Exponat Wasserstampfer
Die ungewöhnliche Form, die Verzierung und die möglicherweise nicht (mehr) geläufige Verwendung eines Wasserstampfers wirft verschiedene Fragen beim*bei der Betrachter*in auf. Indem diese gestellt und gemeinsam beantwortet werden, nähert man sich dem Objekt, erkennt seine Funktionsweise sowie Bedeutung, Herkunft, Material usw.
Czech, Alfred/Kirmeier, Josef/Sgoff, Brigitte (Hg.): Museumspädagogik – Ein Handbuch. Grundlagen und Hilfen für die Praxis, Schwalbach/Ts. 2014, S. 204.
- Details
- Erhaltungszustand
- Farbigkeit
- Funktion
- Gestaltung
- Kulturhistorischer Zusammenhang
- Materialität
- Symbole
- Ästhetik
- bis 3 Jahre
- 3-6 Jahre
- 6-10 Jahre
- 10-13 Jahre
- 13-16 Jahre
- 16-18 Jahre
- Familien
- Kinder und Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Diese Methode lenkt die Aufmerksamkeit auf Details und Ausschnitte.
Die Teilnehmer*innen schauen durch einen Rahmen, eine Papierröhre oder ein mit der Hand simuliertes Fernrohr, um Einzelheiten zu fokussieren. Dadurch „haken“ die Besucher*innen ein Ausstellungsobjekt nicht mit einem Blick ab. Die Methode verlängert die Aufmerksamkeit, indem sie ein Exponat durch Bildausschnitte in viele „Blicke“ zerlegt. Die Fragmentierung löst die Selbstverständlichkeit eines Objekts auf.
Anwendung auf das Exponat Wasserstampfer
Indem sich die Teilnehmer*innen auf Details des Wasserstampfers konzentrieren, entstehen Fragen, deren Beantwortung zur Bedeutung und damit zur Funktion und Handhabung des Objektes führt. Dabei werden auch der historische und kulturelle Hintergrund dieses Exponats deutlich.
Dreykorn, Monika: Methoden im Museum, in: Wagner, Ernst/Dreykorn, Monika (Hg.): Museum, Schule, Bildung: Aktuelle Diskurse, innovative Modelle, erprobte Methoden, München 2007, S. 169–179, hier: S. 170.
Bundesverband Museumspädagogik: Methodensammlung Museen und Kindergärten, 2010, Nr. 24, 25, 44, https://www.museen-und-kindergaerten.de/methodenkartei/alle-methoden-auf-einen-klick/
- Details
- Erhaltungszustand
- Farbigkeit
- Funktion
- Gestaltung
- Kulturhistorischer Zusammenhang
- Materialität
- Symbole
- Ästhetik
- bis 3 Jahre
- 3-6 Jahre
- 6-10 Jahre
- 10-13 Jahre
- 13-16 Jahre
- 16-18 Jahre
- Familien
- Kinder und Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Die Teilnehmer*innen schreiben einen eigenen, kurzen Text zu einem Exponat, das sie zuvor in der Gruppe, in Partner- oder Einzelarbeit erschlossen haben.
Der Text der Teilnehmer*innen soll Besucher*innen über Nutzung, Entstehung, Herkunft und Bedeutung des Exponats informieren. Was mit bloßem Auge zu sehen ist, wie Form, Farbe und Größe, gehört nicht in den Text.
Einige Hinweise vorab erleichtern den Teilnehmer*innen das Schreiben, so z. B.:
- klare, einfache Aktivsätze formulieren
- Füllwörter und Tautologien vermeiden
- treffende und witzige Überschriften finden.
Dabei können informative Sachtexte oder freie Texte in Form von Interviews, Gesprächen oder Erzählungen verfasst werden.
Anwendung auf das Exponat Wasserstampfer
Der Wasserstampfer ist ein funktionales Objekt mit ritueller Bedeutung. Gerade ältere Kinder und Jugendliche können beim Schreiben das zuvor gemeinsam mit dem*der Vermittler*in erschlossene Wissen fantasievoll umsetzen und somit die über die bloße Nutzungsfunktion hinausgehenden Hintergründe erfassen.
Büchert, Gesa/Burkhardt, Hannes: Migrationsgeschichte sammeln, sortieren und zeigen. Ein Leitfaden für Lehrkräfte an Gymnasien und Realschulen, 2014, S. 195–203, online: http://www.geschichtsdidaktik.ewf.uni-erlangen.de/migrationsgeschichte.pdf
- Details
- Erhaltungszustand
- Farbigkeit
- Funktion
- Gestaltung
- Kulturhistorischer Zusammenhang
- Materialität
- Symbole
- Ästhetik
- bis 3 Jahre
- 3-6 Jahre
- 6-10 Jahre
- 10-13 Jahre
- 13-16 Jahre
- 16-18 Jahre
- Familien
- Kinder und Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Fragen vor und zu den Exponaten legen die Charakteristika, Gemeinsamkeiten und Zusammenhänge durch die Anschauung des Objekts offen.
Fragen sind so zu stellen, dass es die Teilnehmer*innen reizt, sie zu beantworten. Lassen sich die Fragen aus der Betrachtung der Exponate beantworten? Bauen sie aufeinander auf, und folgen sie einem roten Faden? Treffen sie das Anspruchsniveau der Gruppe? Offene Fragen und Vergleiche ermöglichen es, Bilder und Objekte mit eigenen Augen und Worten zu entdecken. Vermittler*innen kommen dabei ohne Hintergrundwissen der Teilnehmer*innen aus, können sich aber auch gezielt auf deren Vorwissen beziehen.
Anwendung auf das Exponat Wasserstampfer
Unabhängig vom Vorwissen können vorrangig Kinder und Jugendliche mit gezielten Fragen zu Antworten geführt werden, welche ihnen den Wasserstampfer erklären. Beispielsweise kann man sie fragen, wofür man ihrer Meinung nach dieses Gerät verwenden kann oder wie es gehandhabt wird und von wem. Interessant wären auch Fragen zum Erhaltungszustand oder Details, die vielleicht Hinweise auf die Funktion geben können.
Czech, Alfred/Wagner, Ernst (Hg.): „Ins Museum“, in: Kunst + Unterricht, Heft 323/324, 2008, S. 48.
- Details
- Erhaltungszustand
- Farbigkeit
- Funktion
- Gestaltung
- Kulturhistorischer Zusammenhang
- Materialität
- Symbole
- Ästhetik
- bis 3 Jahre
- 3-6 Jahre
- 6-10 Jahre
- 10-13 Jahre
- 13-16 Jahre
- 16-18 Jahre
- Familien
- Kinder und Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

&
Über Bild- und Kartenmaterial lokalisieren die Teilnehmer*innen den ursprünglichen Standort des Exponats.
Mit Kartenmaterial, Globus und Fotografien werden Fragen beantwortet, wie: Wo kommt das Exponat her? Welche politischen und wirtschaftlichen Zustände herrschen dort? Wie sind das Klima und der Lebensraum am ursprünglichen Standort und wie ist das Exponat zu uns gekommen?
So wird das Exponat in seinen geografischen, ökologischen, historischen, politischen und wirtschaftlichen Zusammenhang gestellt.
Die Karten können auch selbst z. B. auf Stoff oder als Puzzleteile gestaltet werden.
Anwendung auf das Exponat Wasserstampfer
Der Wasserstampfer kommt aus einer Region, die sehr reich an Ritualen ist, die teilweise heute noch durchgeführt werden. Mithilfe der Herkunftsbestimmung erschließen sich die Teilnehmer*innen verschiedene Hintergründe über den ursprünglichen Herkunftsort (etwa historische, religiöse, gesellschaftliche, klimatische, geografische ...).
Diercke Weltatlas, Braunschweig 2015.
Rendgen, Sandra/Wiedemann, Julius: Understanding the World. The Atlas of Infographics, Köln 2014.
Meyers Großes Länderlexikon. Alle Länder der Erde kennen - erleben - verstehen, 2. Aufl., Berlin 2008.
- Details
- Erhaltungszustand
- Farbigkeit
- Funktion
- Gestaltung
- Kulturhistorischer Zusammenhang
- Materialität
- Symbole
- Ästhetik
- bis 3 Jahre
- 3-6 Jahre
- 6-10 Jahre
- 10-13 Jahre
- 13-16 Jahre
- 16-18 Jahre
- Familien
- Kinder und Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Museumsobjekte werden mit Hilfe weiterer Exponate oder geeigneter Zusatzmaterialien in ihren ursprünglichen kulturellen oder alltagsgeschichtlichen Zusammenhang gebracht.
Viele Exponate sind ihres ursprünglichen Zusammenhangs beraubt und bleiben für den*die Betrachter*in abstrakt. Der Kontext, die Funktion o. Ä., ist aber für das Verständnis des Objekts wesentlich. Ziel ist es, diese Objekte mittels geeigneter Exponate oder didaktischer Materialien (Abbildungen, Vergleichsobjekte, haptische Gegenstände ...) wieder in ihren ursprünglichen Kontext zu rücken. Eventuell lassen sich Museumsexponate in einem anschließenden Stadtrundgang im originalen Kontext verorten.
Anwendung auf das Exponat Wasserstampfer
Der Wasserstampfer wird im Rahmen von Ritualen benutzt, bei denen weitere Objekte im Einsatz sind, beispielsweise bestimmte Musikinstrumente, Masken, Kleidung, Schmuck etc. Je nachdem, welche weiteren Exponate ausgestellt sind, kann man sie im Zusammenhang mit dem Wasserstampfer besprechen und die dazu gehörenden Hintergründe erläutern. Damit wird das Exponat in seinen ursprünglichen Zusammenhängen betrachtet, was ein tieferes Verständnis ermöglicht.
Bauereiß, Michael: Vom Museum in den Stadtraum, in: Czech, Alfred/Kirmeier, Josef/Sgoff, Brigitte (Hg.): Museumspädagogik. Ein Handbuch. Grundlagen und Hilfen für die Praxis, Schwalbach/Ts. 2014, S. 282–286.
- Details
- Erhaltungszustand
- Farbigkeit
- Funktion
- Gestaltung
- Kulturhistorischer Zusammenhang
- Materialität
- Symbole
- Ästhetik
- bis 3 Jahre
- 3-6 Jahre
- 6-10 Jahre
- 10-13 Jahre
- 13-16 Jahre
- 16-18 Jahre
- Familien
- Kinder und Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Die Teilnehmer*innen betrachten das Objekt unvoreingenommen und beschreiben das, was sie sehen.
Durch die Betrachtung beginnt das Objekt zu sprechen. Gezielte Fragestellungen des Vermittlers/der Vermittlerin führen zu einer bewussteren Wahrnehmung, die es den Teilnehmern/innen ermöglicht, sich ohne Vorkenntnisse dem Exponat zu nähern. Damit wird der Blick des/der Betrachters*in unverstellt auf das Exponat gelenkt.
Anwendung auf das Exponat Wasserstampfer
Unter verschiedenen Aspekten betrachtet, kommt man auch ohne jegliches Vorwissen der funktionellen, rituellen, historischen usw. Bedeutung des Objektes näher.
Czech, Alfred/Kirmeier, Josef/Sgoff, Brigitte (Hg.): Museumspädagogik - Ein Handbuch, Schwalbach 2014, S. 204.
- Details
- Erhaltungszustand
- Farbigkeit
- Funktion
- Gestaltung
- Kulturhistorischer Zusammenhang
- Materialität
- Symbole
- Ästhetik
- bis 3 Jahre
- 3-6 Jahre
- 6-10 Jahre
- 10-13 Jahre
- 13-16 Jahre
- 16-18 Jahre
- Familien
- Kinder und Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Teilnehmer*innen überlegen sich eigene erfundene Titel für Exponate.
Der bestehende Titel sollte unbekannt sein. Er kann bei einer Führung kurzzeitig abgedeckt werden. Die Teilnehmer*innen schreiben einen eignen Titel auf einen Zettel. Die Zettel werden dann auf den Boden vor das Objekt gelegt und in der Gruppe besprochen. Optional können die Teilnehmer*innen auch über die Vorschläge abstimmen.
Variante: Ein Gruppenteil schließt die Augen und der andere Gruppenteil überlegt sich einen Titel und nennt diesen der „blinden“ Gruppe. Danach erklärt die „blinde“ Gruppe, ob der erfundene Titel ihrer Meinung nach zum Exponat passte.
Anwendung auf das Exponat Wasserstampfer
Die Teilnehmer*innen suchen nach einem passenden Titel für den Wasserstampfer und machen sich dadurch Gedanken über seine Funktion. Gleichzeitig entstehen bei der Betrachtung und Beschäftigung mit dem Objekt auch Ideen, welche über seine Funktion hinausgehen. Anschließend führt der*die Vermittler*in wieder zur Funktion des Objektes zurück.
Bundesverband Museumspädagogik: Methodensammlung Museen und Kindergärten, 2010, Nr. 71, https://www.museen-und-kindergaerten.de/methodenkartei/alle-methoden-auf-einen-klick/
- Details
- Erhaltungszustand
- Farbigkeit
- Funktion
- Gestaltung
- Kulturhistorischer Zusammenhang
- Materialität
- Symbole
- Ästhetik
- bis 3 Jahre
- 3-6 Jahre
- 6-10 Jahre
- 10-13 Jahre
- 13-16 Jahre
- 16-18 Jahre
- Familien
- Kinder und Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
- Menschen mit besonderen Bedürfnissen
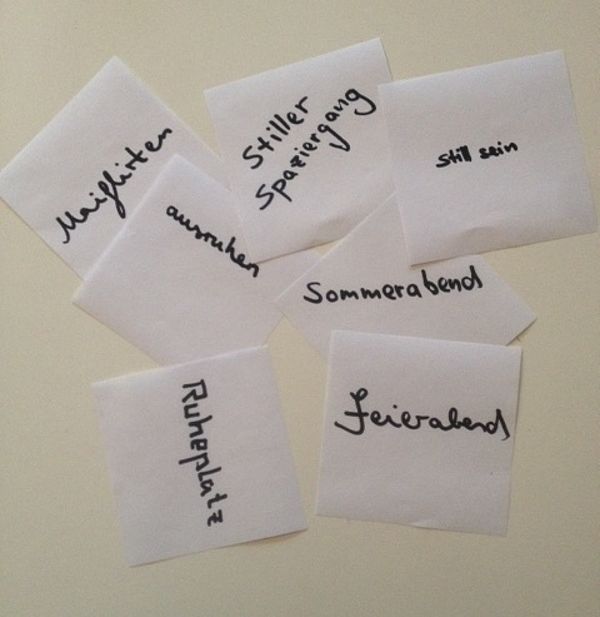
Die Teilnehmer*innen vertonen ein Objekt mit Geräuschen oder Musik.
Sie betrachten ein Objekt und sprechen über die Geräusche und Töne, die ihrer Meinung nach zu dem Objekt passen. Dann stellen sie die Geräuschkulisse nach. Das kann ohne Requisiten durch Sprechen, Singen, Klatschen, Stampfen und Pfeifen geschehen oder mit Musikinstrumenten und Requisiten, die Geräusche erzeugen.
Anwendung auf das Exponat Wasserstampfer
Da es sich beim Wasserstampfer um ein Gerät zur Klangerzeugung handelt, rundet eine Vertonung die Besprechung des Objektes ab. Diese lässt sich jedoch aufgrund räumlicher Gegebenheiten nur schwer praktisch umsetzen, daher ist die Fantasie der Teilnehmer*innen gefragt. Den Erläuterungen der Vermittlungsperson folgend, ahmen sie mit Mund und Händen den möglichen Klang des Wasserstampfers nach. Alternativ können auch Dinge benutzt werden, welche ein vergleichbares Geräusch erzeugen.
Lischka-Seitz, Christiane/Schidlo, Armin/Thumann, Nicola/Früinsfeld, Gert: Skulptur und Klang. Klangbilder - angeregt durch Werke des Bildhauers Lothar Fischer, in: Kunz-Ott, Hannelore (Hg.): Museum und Schule. Wege zu einer erfolgreichen Partnerschaft, München/Berlin 2005, S. 233–237.
Leßmann, Sabine: ViM – Vorschulkinder ins Museum! Bausteine für die museumspädagogische Arbeit mit Vorschulkindern in Kunstmuseen. Ein Modellprojekt im Kunstmuseum Bonn, 2011, in: http://www.kunstmuseum-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Bildung__Vermittlung/Bro_ViM_lay07.pdf
- Details
- Erhaltungszustand
- Farbigkeit
- Funktion
- Gestaltung
- Kulturhistorischer Zusammenhang
- Materialität
- Symbole
- Ästhetik
- bis 3 Jahre
- 3-6 Jahre
- 6-10 Jahre
- 10-13 Jahre
- 13-16 Jahre
- 16-18 Jahre
- Familien
- Kinder und Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
- Menschen mit besonderen Bedürfnissen










