Messrad
Verfasst von:

L: 1 m, B: 0,15 m, T : 0,45 m
Material/Technik:Holz, Metall
Beschreibung zu diesem Beispiel
Mit dem „Messrad Nr. 1022“ von S. Sartorius, können lange Strecken gemessen werden, ohne dass sich die messende Person bücken muss oder auf die Hilfe einer weiteren Person angewiesen ist. Mit der Achse des Laufrads wird ein Zählwerk angetrieben. Aus dem Umfang des Laufrads und der Anzahl der Umdrehungen ergibt sich dann die Länge der Wegstrecke. Das Streckenmessgerät erlaubt sowohl Vorwärts- als auch Rückwärtsmessungen und wurde aus Holz und Metall um das Jahr 1920 gefertigt. Messräder wurden bereits vor Christi Geburt in Rom entwickelt, und sind für bestimmte Anwendungen (z. B. im Handwerk, beim Ausmessen von Leitungslängen) immer noch im Einsatz. Messräder sind die Vorläufer heutiger Kilometerzähler in Fahrzeugen. So wurde z. B. im Jahr 1525 die Strecke von Paris nach Amiens gemessen, indem der Leibarzt Ludwigs XIV., J.A. Fernel, ein Messrad an seinem Reisewagen befestigte.
Brachner, Alto: Von Ellen und Füßen zur Atomuhr: Geschichte der Meßtechnik, 2. Aufl., München 2005, S. 22–24.
Merschmeyer-Brüwer, Carla/Schipper, Wilhelm: Größen und Messen, in: Einsiedler, Wolfgang u. a.: Handbuch Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik, 4. Aufl., Bad Heilbrunn 2014, S. 497–500.
Passende IMPULSE anzeigen
Aspekte, Zielgruppen & MethodenHilfe
Aspekte

Die Teilnehmer*innen erschließen sich Materialeigenschaften und Funktionsweisen von Werkzeugen, Geräten und Gebrauchsgegenständen durch eigenes Experimentieren.
Nach einer kurzen Einweisung fordert der*die Vermittler*in sie auf, Materialien zu erkunden, ein Verfahren, eine Technik selbst auszutesten oder ein Gerät anzuwenden. Hierbei ist es wichtig, dass der*die Vermittler*in den Schwerpunkt auf das Erproben und die eigene Erfahrung legt und nicht die Perfektion und die Vollständigkeit der Tätigkeit das Ziel ist. Z. B. weben die Teilnehmer*innen mit einem nachgebauten Webstuhl oder legen eine römische Toga an. Dadurch können sie den Zeitaufwand und die nötige Handfertigkeit nachvollziehen.
Anwendung auf das Exponat Messrad
Die Teilnehmer*innen formen Papier-Maßbänder oder Papierstreifen mit einer bestimmten Länge zu einem Ring und kleben diesen mit Klebeband zu. Mit dem Ring können sie eine Strecke im Raum ausmessen, ohne das Maßband immer wieder neu anzusetzen. So kann das Prinzip eines Messrads mit sehr einfachen Mitteln selbst erfahren werden. Die Teilnehmer*innen können leicht erfassen, dass es keine Rolle spielt, ob eine Länge gerade oder gebogen ist.
Dreykorn, Monika, Methoden zur Nachbereitung eines Museumsbesuchs, in: Wagner, Ernst/Dreykorn, Monika (Hg.): Museum. Schule. Bildung, München 2007, S. 182.
Hille, Carmen: Geschichte im Blick. Historisches Lernen im Museum, in: Czech, Alfred/Kirmeier, Josef/Sgoff, Brigitte (Hg.): Museumspädagogik. Ein Handbuch. Grundlagen und Hilfen für die Praxis, Schwalbach 2014, S. 84–90, 276–278.
Bundesverband Museumspädagogik: Methodensammlung Museen und Kindergärten, 2010, Nr. 51, https://www.museen-und-kindergaerten.de/methodenkartei/alle-methoden-auf-einen-klick/
- Arbeitserleichterung
- Einsatzgebiet
- Funktionsweise
- Größe
- Messen
- Physikalische Einheiten
- Werkzeug
- 6-10 Jahre
- 10-13 Jahre
- 13-16 Jahre
- 16-18 Jahre
- Familien
- Kinder und Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Die Teilnehmer*innen schreiben einen eigenen Audioguide-Text zu einem Exponat, das sie zuvor in der Gruppe erschlossen haben.
Sie verfassen den Text zunächst in schriftlicher Form. Danach nehmen sie ihn mit Hilfe eines Computers oder eines MP3-Players als Hörtext auf.
Einige Hinweise erleichtern das Schreiben und Aufnehmen:
- Texte von max. 240 Wörtern schreiben
- das Exponat kurz beschreiben
- interessante, zusammenhängende Geschichte erzählen
- kurze, einfache Aktivsätze formulieren
- Alltagssprache verwenden
- Fachbegriffe vermeiden oder erklären
- passende Geräusche einbauen
- bei der Aufnahme langsam und deutlich sprechen
Im Anschluss hören die Teilnehmer*innen vor dem Exponat den Hörtext an.
Anwendung auf das Exponat Messrad
Die Gruppe wird in Kleingruppen aufgeteilt. Jeder Kleingruppe wird ein Exponat zugewiesen, das zum Thema Messungen gehört. Die Teilnehmer*innen erschließen anhand der Beschriftung und der Erklärtafeln im Museum die Funktionsweise und Einsatzgebiete des Messrads bzw. der anderen Exponate und verfassen in Gruppenarbeit einen Text mit max. 240 Wörtern. Dabei versuchen sie kurze verständliche Sätze zu verwenden. Anschließend nehmen sie den Text z. B. mit ihrem Handy auf und untermalen ihn ggf. mit Geräuschen. Im Anschluss präsentieren die Teilgruppen jeweils bei ihrem Exponat ihr Tondokument.
Wenzel, Birgit: Kreative und innovative Methoden. Geschichtsunterricht einmal anders, Schwalbach/Ts. 2010, S. 40–46.
https://www.audiobeitraege.de/category/schreiben-fuers-hoeren/
https://www.tanjapraske.de/wissen/lehre/schreiben-fuers-hoeren-audioguides-und-apps/
- Arbeitserleichterung
- Einsatzgebiet
- Funktionsweise
- Größe
- Messen
- Physikalische Einheiten
- Werkzeug
- 6-10 Jahre
- 10-13 Jahre
- 13-16 Jahre
- 16-18 Jahre
- Familien
- Kinder und Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
- Menschen mit besonderen Bedürfnissen
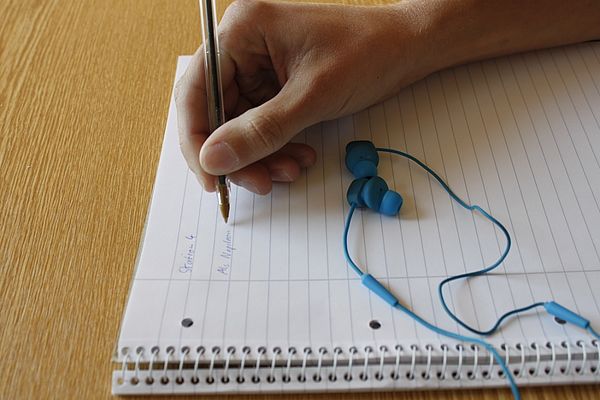
Wissen und Informationen werden auf unterhaltsame und einprägsame Weise mündlich weitergegeben.
Vergangene Ereignisse und Erlebnisse werden in Form von Geschichten vermittelt. Der*die Erzähler*in vergegenwärtigt zurückliegende Erfahrungen, häufig im Stil eines Märchens oder einer spannend vorgetragenen Geschichte, und bindet die Zuhörer*innen aktiv ein. Auf diese Weise wird die Vermittlung von Wissen und Werten mit dem Hervorrufen von Emotionen verknüpft. Informationen können leichter verinnerlicht und gespeichert werden. Erzähler*in und Zuhörer*innen sind aktiv eingebunden und es kann zu einem Erfahrungs- und Wissensaustausch kommen.
Anwendung auf das Exponat Messrad
Auf spielerische und unterhaltsame Weise wird erzählt, wo und wie Streckenmessräder zum Einsatz kommen. Dazu kann auch eine ausgedachte Geschichte erzählt werden, z. B. von einem Schuster der wissen möchte, wie lange er gehen kann, bis seine Schuhe durchgelaufen sind. Oder von einem Läufer, der nicht glauben möchte, dass eine Stadionbahn die angegebene Länge hat. Oder einem Elektriker, der ein Telefonkabel verlegen muss. So können verschiedene Einsatzgebiete des Messrades aufgezeigt werden.
Claussen, Claus: Mit Kindern Geschichten erzählen. Konzept - Tipps - Beispiele. Berlin 2006.
Reich, Kersten (Hg.): Methodenpool, methodenpool.uni-koeln.de.
- Arbeitserleichterung
- Einsatzgebiet
- Funktionsweise
- Größe
- Messen
- Physikalische Einheiten
- Werkzeug
- 6-10 Jahre
- 10-13 Jahre
- 13-16 Jahre
- 16-18 Jahre
- Familien
- Kinder und Jugendliche
- Erwachsene
- Senioren
- Menschen mit besonderen Bedürfnissen







